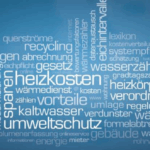4th Life Photography - stock.ado - © by Dariusz T. Oczkowicz
4th Life Photography - stock.ado - © by Dariusz T. OczkowiczDie Abrechnung nach dem Abflussprinzip ist bei Heizkosten unzulässig. So lautet das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 1. Februar 2012 (Az.: VIII ZR 156/11). Damit dürfen Vermieter und Verwalter in der Heizkostenabrechnung nur noch die tatsächlich im Abrechnungszeitraum verbrauchten Brennstoffe ansetzen, nicht aber die geleisteten Abschlagszahlungen an den Energieversorger. Gerade bei Gas- und Fernwärmelieferungen kommt es jedoch häufig vor, dass der Abrechnungszeitraum des Versorgers nicht mit dem des Gebäudes übereinstimmt. Welche Möglichkeiten gibt es, um trotzdem eine rechtssichere Abrechnung zu erstellen?
Warum die Abrechnung nach dem Abflussprinzip unzulässig ist
Früher war es in der Wohnungswirtschaft üblich, bei abweichenden Abrechnungszeiträumen einfach die Abschlagszahlungen für die Heizkosten anzusetzen und diese im Folgejahr mit der Endabrechnung zu korrigieren. Diese Praxis ist heute nicht mehr zulässig.
Der BGH hat in seinem Urteil § 7 Abs. 2 der Heizkostenverordnung ausgelegt. Danach dürfen nur Kosten für tatsächlich verbrauchte Brennstoffe angesetzt werden. Abschlagszahlungen stellen dagegen nur geschätzte Werte dar, sie sind keine verbrauchten Brennstoffe im Sinne der Verordnung.
Was Vermieter und Verwalter rund um die Abrechnung nach dem Abflussprinzip beachten sollten
Für eine korrekte Heizkostenabrechnung nach dem Leistungsprinzip gibt es drei mögliche Wege:
1. Zwischenabrechnung beim Energieversorger anfordern
Lesen Sie den Versorgungszähler zum Ende Ihres Wirtschaftsjahres selbst ab, zum Beispiel zum 31. Dezember, und übermitteln Sie den Stand dem Versorger. Dieser stellt Ihnen dann eine Zwischenabrechnung aus, die exakt den tatsächlichen Verbrauch im Abrechnungszeitraum ausweist. Diese Methode ist besonders bei professionellen Verwaltern verbreitet und rechtssicher.
2. Abrechnungszeitraum anpassen
Stimmen Sie den Heizkosten-Abrechnungszeitraum auf den Versorgungszeitraum ab. Wenn der Energieversorger beispielsweise immer zum 30. September abrechnet, kann auch der Heizkostenzeitraum entsprechend enden. Das ist besonders für private Vermieter sinnvoll, da sie meist flexibler in der Gestaltung des Abrechnungszeitraums sind. Wichtig: Die Abrechnungsperiode darf dabei maximal zwölf Monate betragen.
3. Energieversorger bittet um Anpassung
Manche Versorger bieten an, ihre Abrechnungszeiträume dem Wirtschaftszeitraum des Gebäudes anzupassen. Das kann besonders für größere Wohnungsunternehmen sinnvoll sein. Klären Sie im Vorfeld, ob diese Möglichkeit besteht, vertraglich verpflichtet ist der Versorger dazu jedoch nicht.
Gilt das auch für andere Betriebskosten?
Nein. Das BGH-Urteil zur Abrechnung nach dem Abflussprinzip betrifft ausschließlich die Heiz- und Warmwasserkosten. Bei kalten Betriebskosten, also z. B. Allgemeinstrom, Kaltwasser oder Müll – dürfen weiterhin Abschlagszahlungen angesetzt werden. Grundlage ist ein früheres Urteil vom 20. Februar 2008 (Az.: VIII ZR 49/07), das wegen des damit verbundenen Aufwands eine andere Rechtsauffassung rechtfertigt.
Besonderheit bei Eigentümergemeinschaften
Für die Gesamtabrechnung einer WEG gilt eine zusätzliche Regel: Hier müssen alle tatsächlichen Geldflüsse aufgeführt werden, unabhängig von der Heizkostenabrechnung. Das entschied der BGH am 17. Februar 2012 (Az.: V ZR 251/10). Neben der reinen Verbrauchskostenabrechnung ist daher eine verständliche Einnahmen- und Ausgabenrechnung erforderlich.
Fazit: Abrechnung nach dem Abflussprinzip vermeiden
Die Abrechnung nach dem Abflussprinzip ist bei Heizkosten nicht zulässig, das BGH-Urteil schafft hier klare Verhältnisse. Vermieter und Verwalter sollten eine der drei beschriebenen Lösungen nutzen, um ihre Heizkostenabrechnung rechtssicher und nachvollziehbar zu gestalten. Nur so lassen sich spätere Korrekturen, Auseinandersetzungen mit Mietern und unnötiger Aufwand vermeiden.
 InsideCreativeHouse – Adobestock
InsideCreativeHouse – AdobestockImmer auf dem neusten Stand
„*“ zeigt erforderliche Felder an